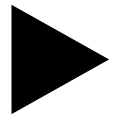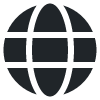NS-Verfolgung Homosexueller - Geschichtliche Hintergründe und Aufarbeitung
Die Verfolgung Homosexueller während der NS Zeit in Österreich
Die Kriminalisierung männlicher und weiblicher Homosexualität in Österreich reicht lange zurück. Grundlage bildete der Strafrechts-Paragraph 129, der von 1852 bis zur „Kleinen Strafrechtsreform“ 1971 beinahe unverändert galt. Während des Austrofaschismus gab es in den Kripo-Leitstellen Referate zur Bekämpfung von Sittlichkeitsverbrechen und Prostitution, dessen Personal auch für die Verfolgung homosexueller Handlungen zuständig war. Der §129 blieb auch nach dem sogenannten „Anschluss“ Österreichs an das Deutsche Reich im März 1938 aufrecht und stellte weibliche Homosexualität genauso unter Strafe wie männliche, obwohl der entsprechende in Deutschland geltende §175 nur männliche „Unzucht“ bestrafte. Am 1. April 1938 nahm das „Referat II S 1“ der Gestapo-Leitstelle Wien seine Arbeit auf, forschte Homosexuelle aus und brachte sie vor Gericht. Damit verschärfte sich die Situation für homosexuelle Männer und Frauen drastisch. Von den Behörden administriert begann nun eine bis dahin in Österreich beispiellose Jagd auf Homosexuelle, die sie vor Gericht, in die Gefängnisse, in die Konzentrationslager, auf den Operationstisch oder in die Psychiatrie brachte und oftmals mit ihrem Tod endete.
Diskriminierung und Verfolgung nach 1945
Nach der Befreiung Österreichs 1945 bestand eine klare Kontinuität in der Strafverfolgung von Homosexuellen, der §129 behielt seine Gültigkeit. Die mit dem Vorwurf der Homosexualität Verfolgten wurden nicht als Opfer des Nationalsozialismus anerkannt. Haftentlassene schwiegen über den Grund ihrer Strafhaft, die aus den Konzentrationslagern zurückgekehrten überlebenden männlichen „Rosa-Winkel-Häftlinge“ sahen sich der gleichen gesellschaftlichen Ächtung ausgesetzt wie zuvor. Noch jahrzehntelang setzte die Wiener Kriminalpolizei ihre Arbeit fort und verfolgte und verhaftete Männer und Frauen wegen „Unzucht wider die Natur“. Mit der „Kleinen Strafrechtsreform“ 1971 wurde zwar das „Totalverbot“ aufgehoben, aber vier neue Tatbestände eingeführt (§ 209, § 210, § 220, § 221), die Homosexuelle weiterhin juristisch diskriminierten. Nur schrittweise wurden diese zwischen den Jahren 1989 und 2002 aufgehoben.
Aktueller Forschungsstand
Der Stand der Forschung und das allgemeine Wissen über die NS-Homosexuellenverfolgung sind auch im Jahre 2023 immer noch recht dürftig; und auch erinnerungskulturell finden sich nur wenige Gedenkzeichen – häufig temporäre künstlerische Interventionen –, wenn es um diese Opfergruppe geht. Die österreichischen Universitäten nahmen sich dem Thema nur sehr zögerlich an, die spät einsetzende professionelle Forschung wurde vor allem von schwulen und lesbischen, oftmals aktivistischen WissenschafterInnen, vorangetrieben. Für Wien liegen dank der Forschungstätigkeit des Zentrums QWIEN bereits valide Ergebnisse vor. In den letzten zehn Jahren legte QWIEN auf der Basis von Strafakten eine umfangreiche Opferdatenbank an. Die im Mai 2023 erschienene Publikation von Andreas Brunner (QWIEN) „Als homosexuell verfolgt" stellt über 50 Biografien queerer Menschen vor, die aufgrund ihrer Sexualität im Nationalsozialismus in Wien verfolgt wurden. Im Juni 2023 folgte eine Publikation von QWIEN, mit der sie eine weitere Forschungslücke für Wien schlossen: "Homosexualität und Nationalsozialismus in Wien". Auch in den anderen Bundesländern wird im Zuge des Jahresschwerpunkts die Forschung zu verfolgten Homosexuellen nach und nach vertieft und Biografien, wie die des Burgenländers Mathias Bauer treten zu Tage. Die Stadt Linz hat im August 2023 die Durchführung eines Forschungsprojektes zur Verfolgung homosexueller Menschen vor allem in der NS-Zeit beschlossen; 2026 sollen die Ergebnisse in einem Sammelband präsentiert werden. Weiters thematisiert das Gaismair-Jahrbuch 2024 "Alles in Ordnung" die Homosexuellenverfolgung in Österreich. Der Beitrag der Historikerin Elisa Heinrich, der in diesem Jahrbuch erschien, analysiert Kontinuitäten in Verfolgung und Diskriminierung Homosexueller nach 1945.
Kategorisierung
- Stichworte
- NS-Verfolgung Homosexueller